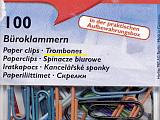Schmiedeberg – Wo ist denn das?
Schmiedeberg? Wo um alles in der Welt liegt das? waren die Standardfragen, die ich von allen zu hören bekam, denen ich vor der Abreise von meinen 2004er Sommerurlaubsplänen erzählte. Standard auch war meine Antwort hierauf: irgendwo in der Nähe von Dresden. Ich vermutete, daß ich an meinen vielen freien Vormittagen, während die anderen bliesen, häufig nach Dresden fahren würde, um „in Kultur” zu machen.So passiert's, wenn eine sich nicht wirklich auf ihren Urlaub vorbereitet. Natürlich hätte ich auch einen Kult-ur-laub machen können und jeden Tag nach Dresden hineinfahren. Es kam aber ganz anders.
Schmiedeberg also. Wo liegt es denn nun? Heute antworte ich: im Ost-Erzgebirge, nicht weit von der tschechischen Grenze, ungefähr dreißig Kilometer südlich von Dresden. Und dann erzähle ich noch das eine oder andere von dem, was im folgenden zu lesen sein wird - weiß ich doch als in den fünfziger/sechziger Jahren mit dem inneren Bild einer nur zwei westliche Drittel unseres heutigen Staatsgebietes umfassenden Bundesrepublik Aufgewachsene, daß (wie ich selbst vor der Reise) auch heute noch viele Menschen keine genaue Vorstellung von dieser Landschaft haben.
Damals in Schulzeiten hatte ich mir nur gemerkt, daß „Erzgebirge” irgendwo rechts oben auf der Karte liegt, schon richtig Osten ist und damit für ewige Zeiten unerreichbar. Hatte abstrakt gelernt (und vergessen), daß es hier Bodenschätze en masse gibt (die entsprechende Karte im „Diercke Atlas” steht mir noch heute vor Augen), außerdem geschnitzte Volkskunst, mit der ich nie so richtig etwas hatte anfangen können.
Und was habe ich nun in jenem Urlaub erlebt und gelebt? Um nicht den ganzen Webspace des Posaunenwerks damit zu füllen, kann ich hier nur Fragmente erzählen. Jedenfalls habe ich eine neue Lieblings-Urlaubs-Landschaft gefunden, die sich munter meinen bisherigen persönlichen Favoriten: Toscana, Meran, Harz und dem Land zwischen Tauber, Kocher, Jagst hinzugesellt. Und so freue ich mich auf die Posaunenchor-Sommerfreizeit 2007 ein bißchen mehr als auf die beiden davor in Borkum (2005) und Lechbruck (2006) :-))
Sehr viel zum Wohlfühlen von Anfang an trägt der Leiter des Martin-Luther-King-Hauses, Klaus Geiger bei. Die Begrüßung ist sehr herzlich (die Gruppe ist diesmal zum dritten Mal hier) und persönlich, in den kommenden vierzehn Tagen sollten wir noch manche Gelegenheit zum Gespräch mit einander haben. Auch über die Sommerflut 2002, deren Auswirkungen noch allenthalben zu sehen, zu erleben sind. Dazu im Extra-Bericht mehr. Die freundlich-bestimmte, heiter-entschiedene und persönliches Getragensein vermittelnde unaufdringlich-spirituelle Art, in der Klaus Geiger dies Haus leitet, erfüllt atmosphärisch jeden Winkel, wird auch von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgestrahlt und schafft eine Grundstimmung, die der Erholung seiner Gäste vehement Vorschub leistet.
Am Tag nach der Ankunft ist der erste von zwei Sonntagen, die in die Freizeit fallen. Als jemand, die sich noch relativ neu in der Posaunenchorszene bewegt, staune ich immer wieder, was die Menschen hier um mich herum in ihrem Urlaub auf sich nehmen für ihr Hobby (Blasen im Posaunenchor ist einfach viel mehr als ein „Hobby”, das habe ich schnell gelernt): Der Ad-hoc-Posaunenchor aus Freizeitteilnehmenden wird im Gottesdienst spielen - also ist nach dem Abendessen noch eine Probe in der Kirche angesagt. Ich könnt' das nicht mehr, müde, wie ich bin… Und ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, wie das etwas werden soll. Manche der Teilnehmenden kennen sich aus früheren Jahren, und es sind auch keine absoluten Jungbläser/innen darunter, trotzdem… Eine aus dem Kreis, Klavierlehrerin im echten Leben, wird die Orgel schlagen - die Gemeinde hatte bis Samstag abend noch niemand gefunden, die oder der den Orgeldienst übernehmen würde.
Später, als ich mich zu den bereits seit einer Weile Probenden geselle, höre ich schon richtig Musik. Eine relative Unruhe im Chor ist der Tribut an die eigentlich vorhandene Müdigkeit, aber es wird doch konzentriert mit einander gearbeitet. Die Bläserinnen und Bläser schaffen es schnell, die Ansagen von Johannes Kunkel umzusetzen. Das Allegro von Pepusch aus der Sonate im HBH 2004, an dem sie gerade arbeiten, klingt nach den Hinweisen zu Phrasierung und Toncharakteristik deutlich besser…
Während die anderen musizieren, schaue ich mich in der Kirche um. Ein barockes Schmuckstückchen, gut instand gehalten, aber nicht überperfektionistisch totrestauriert. Die Kirche wurde von George Bähr gebaut, dem gleichen Baumeister, der zehn Jahre später die Frauenkirche in Dresden erbaute. Dessen hiesiger Barock hat nichts süßlich überladenes, die üppigen Deckengemälde mit ausuferndem Bildprogramm fehlen - es ist eben eine evangelische Barockkirche! Der Bau ist der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, und so hat der Baumeister in die Geometrie des Bauwerks viele die Dreifaltigkeit symbolisierende gleichseitige Dreiecke hineingebaut. Altar, Kanzel und Orgel sind übereinander angeordnet - von wegen „Wiesbadener Programm” (das aus der Jugendstilzeit stammt) - die Idee muß älter sein und genau so ur-protestantisch wie die bilderlose Ausstattung der Kirche (um genau zu sein: diese Anordnung findet sich erstmals verwirklicht 1590 in der Schlosskapelle von Schloss Wilhelmsburg, Schmalkalden).
Der Gottesdienst am Tag darauf ist ein eigenes Erlebnis, wie auch derjenige am zweiten Sonntag dieser Freizeit. Beide Male konnten wir Pfarrer kennen lernen, die mit missionarischem Drive und echter, ansteckender Beseeltheit Gottesdienst feierten. Spürbar war auch der vertraute und herzliche Kontakt zu den Menschen in der Gemeinde. Beide Pfarrer berührten mich auf ihre je eigene Weise sowohl mit ihrer liturgischen Kompetenz als auch mit ihren Predigten, die mir Anregungen zum Weiterdenken bzw. Sinnieren über manches mitgaben.
Die kommenden Tage sind - wie zu erwarten war - geteilt. An den Vormittagen erkunde ich den Teil der Gegend, der direkt per pedes erreichbar ist. Überraschend viel läßt sich direkt vom Haus aus erwandern. Zeitweises Faulenzen mit gleichzeitigem Verschlingen mitgebrachter Reiselektüre kommt auch nicht zu kurz - ich sitze dann im Freien zwischen dem Martin-Luther-King-Haus und der zugehörigen Kapelle der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, in der musiziert wird, genieße die Probenklänge, lasse mich gern zwischendurch vom Lesen ablenken, um von Ferne die bläserische Arbeit zu verfolgen. Das Vergnügen, das die Gruppe beim Spielen hat, teilt sich der Hörerin genauso mit wie die Fortschritte, die im Lauf der Arbeit erzielt werden. Manches Mal beziehe ich meinen „Ohrwurm des Tages” aus einem der hier gehörten Stücke, summe es die ganze Zeit innerlich vor mich hin.
Nachmittags ist Zeit für Unternehmungen im Familienkreis oder mit Leuten aus der Gruppe. So komme ich immer wieder durch die schöne erzgebirgische Landschaft auf kleinen und kleinsten Sträßchen, weil wir versuchen, die der Grenznähe wegen viel befahrene Bundesstraße zu meiden. An vielen Stellen sind Baustellen eingerichtet - alles Bemühungen, die Schäden durch das gewaltige Hochwasser vor zwei Jahren zu beheben. Immer wieder sind Brücken über Bachläufe beschädigt oder zerstört und müssen komplett neu errichtet werden. Die Straße wird dann oft auf einer einspurigen Behelfsbrücke darum herum geleitet. Manche Verbindungen sind noch immer komplett gesperrt.
In der Altenberger Gegend, nahe bei Geising erlebe ich einen großen, künstlichen Wasserfall. Er entstand durch die Ableitung des Schwarzbaches zum Zwecke der Entwässerung einer aufgelassenen Bergwerksanlage nebst Spülhalde aus der Erzgewinnung. Für das Wasser, das einstmals unter der Halde hindurchgeführt worden war, nach einem Rohrbruchunfall dann andere Wege geleitet werden mußte, wurde ein richtiger Graben in den Fels geschlagen.
Durch die große, hügelhohe und bewachsene Halde führt auch jetzt noch ein Wetterungs- und Entwässerungs-Stollen. Etwas seitlich vom Weg am Fuß der Halde, die wir uns genauer anschauen wollten, spüren wir plötzlich einen sehr kühlen Lufthauch vor allem die Füße umwehen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, daß massenweise kleine Löchlein im Berg zu sehen sind, mauselochgroß etwa, aus denen der kalte Lufthauch herausweht. Vermutlich sind im Lauf der Zeit kleinere und größere Setzrisse in dieser Halde entstanden, so daß die Luft an diesen Stellen nach außen entweicht. Der Luftstrom, der aus dem Berg kommt, ist derart intensiv, daß ein vor die Öffnung gelegtes Blatt weggeweht wird…
Ein anderer Ausflug führt uns nach Tschechien, ins Kloster Osek. Leider sind wir ein weniges zu spät, um noch die Führung mitzubekommen, bekommen aber dennoch Gelegenheit zu einer Kurzbesichtigung. Die Frau, die an der Kasse sitzt und gerade Feierabend machen wollte, läßt uns freundlicherweise noch in die Kirche. Osek ist ein barockes Zisterzienserkloster, das in den Jahren des Sozialismus säkularisiert war. Zeitweise waren in jenen Jahrzehnten dort Priester und später Ordensfrauen interniert.
Inzwischen lebt wieder eine winzige Gemeinschaft im Kloster (ein Abt, der 1991 dorthin gesandt wurde und ein weiterer Pater, der jedoch zur Zeit aus Studiengründen außerhalb ist). Das Kloster an sich ist jedoch riesig. Die Patres bieten gestrauchelten Menschen Wohnung, Nahrung, Kleidung und Zuspruch, einige finden hier auch Arbeit.
Viele der ehemaligen Nebengebäude sind ganz oder teilweise zerstört. Die Kirche ist von außen bereits restauriert, von innen noch nicht. So ist die barocke Kunst in der Fülle gelebten Lebens erlebbar, mit allem Grauschleier und allen Verwundungen, die so ein Kirchenraum im Lauf der Jahrhunderte erleidet. Fazit nach diesem ersten Eindruck, diesem ersten Kennenlernen: Das Wiederkommen lohnt! (Wer sich zum Kloster informieren will: www.kloster-osek.org, funktioniert leider nur mit Macromedia Flash Player!)
Wie schon erwähnt ist auch am zweiten Sonntag der Chor aus Teilnehmenden der Familienfreizeit musizierender Gast in einem Gottesdienst. Wir haben ein Stück zu fahren - diesmal hat Glashütte (ja das mit den berühmten Uhren) den Besuch des Posaunenchores geschenkt bekommen. Klaus Geiger spricht stets mit den Gemeinden ab, welche Gottesdienste musizierende Gäste des Martin-Luther-King-Hauses mitgestalten. Auf diese Weise kommen im Lauf des Jahres gleichmäßig in allen Gemeinden der Umgebung musikalisch besonders gestaltete Gottesdienst zustande.
Mit der Glashütter Kirche betreten wir erneut ein Kleinod, das genauer zu betrachten sich wahrhaftig lohnt. Bitte, liebe Leserin, lieber Leser, bewerte die folgende Aussage nicht als zynisch! …ich bin froh, daß hier nicht so viel Kapital vorhanden ist, Kirchen und Bauwerke kaputtzurestaurieren (letzteres lässt sich in mancher süddeutschen Barock-Kirche trefflich beobachten). So behalten sie ihr Flair, das von dem in ihnen gelebten Glaubensleben manches mitteilt, unter-bewußt mitteilt: mensch nimmt es auf beim Umhergehen und Betrachten. Anstatt mit dem Gefühl, ein Kunstwerk zu besichtigen, das einer zwangsläufig manches „Ah” und „Oh” entreißt, das mit gewaltigen Deckengemälden und Unmengen von Blattgold oft genug auch den Eindruck von Protz und Prunk vermittelt, gehe ich in diesen ostdeutschen Kirchen herum und spüre, daß die künstlerische Ausgestaltung Ausdruck des Glaubens der Menschen ist, die hier gelebt und gebetet haben. Es handelt sich übrigens in Glashütte weitestgehend um eine Ausgestaltung im Stil der späten Renaissance.
Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Kirche nicht eingewölbt, sondern mit einer flachen Holzdecke versehen. Diese Holz-Kassettendecke wurde bemalt - einer der Schätze dieser Kirche. Die Decke zeigt 94 musizierende Engel. Im eher bäuerlich-naiven Stil ausgeführt, aber hervorragend geeignet zum Studium historischer Musikinstrumente! Die meisten der Engel musizieren mit ziemlich dicken Pausbacken und mit eher angestrengten und unglücklichen Gesichtern, aber auf einer großen Vielfalt von Instrumenten. Es finden sich die meisten Exemplare der Gambenfamilie genauso wie ein Hackbrett, diverse Lauten mit unterschiedlich geknickten Hälsen, ein Streichinstrument, das aussieht wie eine langgezogene Balalaika und beim Spielen auf dem Boden oder auf den Knien steht. Bei den Schlaginstrumenten lassen sich Päuklein und Pauken bewundern, es findet sich aber auch ein Putto, der mit verbissenem Gesicht eine Rahmentrommel spielt und ein anderer, der einen großen Triangel mit verzierten Enden bedient. Ganz verrückt wird es bei den Blechblasinstrumenten: neben drei Engelchen mit Zugposaunen und welchen, die (natürlich ventil-lose) Trompeten spielen, finden sich Hörner mit den kuriosesten Windungen und eine Brezel-Trompete (gebaut in Nürnberg 1585 von Anton Schnitzer, seinerzeit gespielt von Cesare Bendinelli), die Edward Tarr bei seinen Führungen im Säckinger Museum mit Wonne zeigt und gelegentlich vorführt. Und dann wären da noch die Fagotte und Englisch-Hörner. Nicht zu vergessen jener Putto, der eine mittelalterliche Tischorgel spielt. Alles in allem ein himmlisches Orchester, das das Musizieren in diesem Raum besonders anregt!
Weiteres besonderes Schmuckstück: die Kanzel. Die tragende Säule ist ein Bergmann in zeittypischer Arbeitskleidung. Die Figur trägt die Kanzel auf ihrem Kopf und stützt sie mit beiden Händen ab. An der Kanzel selbst finden sich übliche und bekannte Figuren (habe ich gar nicht so genau betrachtet, vermutlich die Evangelisten usw.) und ein ebenso üblicher Kanzeldeckel. Der kanzeltragende Bergmann steht auf einer kleinen Halde aus echtem Haldengestein, und auch die Rückseite des Kanzelaufgangs ist mit Steinen verkleidet, so daß tatsächlich der Eindruck entsteht, die Figur stünde im bergbaulichen Gelände. Für Sozio-Historiker bietet eine solche Figur sicher viel Stoff, denn sicher ist sie mit den alltäglichen Ausstattungsstücken eines damaligen Bergmannes (vermutlich um 1600?) versehen, halt in ihrer normalen Arbeitskleidung dargestellt. Dazu gehört natürlich die Kapuze, außerdem ist der Dargestellte Bartträger und schaut ein wenig rundlich-verschmitzt aus seinem Gesicht, ebenfalls gut eingefangen sind seine Proportionen: die im Berg schuftenden waren damals besonders kleinwüchsig. So erschließt sich aus dieser Figur auch, daß die Märchengestalt des Zwerges, der tief im Berg die Schätze der Erde abbaut und hortet, von den tatsächlichen Bergmännern abgeschaut ist.
Drittes musikalisches Highlight war das Konzert in der Kirche in Altenberg gegen Ende dieser Freizeit - schon fast eine Tradition. Konzentriert hatten die Bläserinnen und Bläser hierauf hin gearbeitet und brachten vor einer rappelvollen Kirche das erarbeitete Programm zu Gehör. Und wieder staunte ich, welche musikalische Qualität von diesem „zusammengewürfelten” Chor erreicht wurde. Ich genoß die Darbietungen alter Musik (Morley und Pepusch) ebenso wie die der zeitgenössischen „Silvester Suite” von Burkhard Mohr, schmolz dahin bei Mendelssohns „Herr sei gnädig unserm Flehen”, schmunzelte, innerlich mitsingend, beim Tribut an die realen Kinder im Publikum und die inneren Kinder in jeder und jedem von uns (Pippi Langstrumpf, Lummerland-Lied und Biene Maja, alles Arrangements von Bernd Limberg), swingte mit bei den Gospelarrangements von Richard Roblee und folgte zu guter Letzt begeistert der Einladung ans Publikum zum Mitsingen von „Hevenu shalom alejchem”. Klar, daß es nicht ohne frenetischen Beifall und entsprechende Zugaben abging…
Vom Engagement und dem Zugehörigkeitsgefühl aller zur Freizeitgruppe gehörenden zeugte für mich auch, daß zum einen zwei der jugendlichen Familienmitglieder (Johanna Knauff und Andreas Schindewolf) Präludium und Fuge F-Dur aus „Acht kleine Präludien und Fugen” von Johann Sebastian Bach während ihrer Urlaubswochen einstudierten und das Bläser/innen/konzert so um organistische Elemente bereicherten. Zum anderen war da noch Karsten Fink (Schlagzeug), ebenfalls heranwachsender „Bläserfamilienangehöriger”, der einen großen Teil seiner Ferienzeit investierte, mit den Bläserinnen und Bläsern zu proben, um im Konzert bei den zeitgenössischen Stücken (von Mohr bis Limberg) das rhythmische Element zu pointieren.
Nicht vergessen will ich die abendliche „Bastelaktion” an einem der ersten Tage. Kryptisch hatte es in der Bestätigunsmail der Anmeldung geheißen, daß kleine Zangen mitgebracht werden sollten, so vorhanden. Des Rätsels Lösung: eine von uns hatte kurze Zeit vor dem Urlaub ein Päckchen Büroklammern erstanden, das EU-Norm-gemäß in allen möglichen Europäischen Sprachen beschriftet war. Verblüfft konnte sie lesen, daß sie eine Schachtel mit 100 „Trombones” erworben hatte (eines der französischen Wörter für Büroklammer). Die Aufgabe für die Gruppe war deshalb, die in der Büroklammer verborgene Posaune sichtbar werden zu lassen. So gab Johannes Kunkel eines Abends ein Döschen hübsch bunter Büroklammern aus, stellte zusätzlich zu den mitgebrachten ein paar weitere Zänglein zur Verfügung - und los ging's.
Mir wurde bewußt, daß ich zwar schon x+1 Mal bei allerlei Blechgebläse-Konzerten anwesend war und die gesamte Palette der Instrumente hatte betrachten können - nun aber vor der Büroklammer sitzend nicht wußte, was wie herum gebogen werden mußte. Dafür waren die Bläserinnen und Bläser reichlich kreativ. Ich staunte, was sie alles zustande brachten: neben Posaunen bogen sie winzige Trompeten, sogar mit Ventilen, ein Horn war dabei, Posaunen mit und ohne Schallstück, jemand dachte an den Notenständer, der nicht fehlen darf, und ein paar Violinschlüssel waren auch dabei. Baßschlüssel waren da schon schwieriger - die Siemens-Lufthaken zum Befestigen der zwei Punkte waren ausgegangen. Eine hübsche Sammlung von alternativen „Bläsernadeln” kam so zusammen. Und der Beweis wurde erbracht, daß Büroklammern tatsächlich verkappte „Trombones” sind.
Noch vieles gäbe es zu erzählen, aber wie gesagt… der Platz…
Ach, und nun wollen Sie noch wissen, wie ich als Nicht-Bläserin auf die abwegige Idee komme, meinen Sommerurlaub bei einer Freizeit für Bläserinnen, Bläser und ihre Familien zu verbringen? O.K., zugegeben, ich bin „Familie”. Darüber hinaus aber habe ich die Atmosphäre in den Freizeitgruppen (ich war dieses Jahr zum dritten Mal dabei und habe jetzt jedes der im Wechsel angesteuerten Ziele erlebt) schätzen gelernt. Genau die richtige Mischung von Nähe und Distanz finde ich hier vor: der Umgang ist herzlich und echt am Gegenüber interessiert. Eigenheiten dürfen sein, werden wahrgenommen und ! angenommen ! Ich kann so viel für mich sein, wie ich es brauche, finde aber immer irgendwen, mit der oder dem ich etwas gemeinsam machen/unternehmen kann, wenn mir danach ist. Als einer, die nicht Auto fährt, ist mir auch wichtig, daß fraglos und selbstverständlich an mich gedacht wird, wenn eine größere Gruppe etwas vorhat, das ohne Auto nicht machbar ist. Ich glaube, hier hätte ich mich sogar wohlfühlen können in meinen leidenschaftlich einzel-reisenden Zeiten.
Und so freue ich mich auf den nächsten Urlaub, 2005 in Borkum. Und ganz besonders auf die nächste Schmiedeberg-Freizeit! Vielleicht dann mit wieder intakter Bimmel-Bahn, die morgens dicht am Martin-Luther-King-Haus vorbeischnauft?
Daniela Stein